Alternativen zu VMware – welche Optionen bieten sich Unternehmen?
VMware ist eine beliebte Virtualisierungsplattform. Als einer der Pioniere im Bereich der Virtualisierung hat die Anwendung eine entsprechend große Verbreitung. Inzwischen hat sich die Plattform jedoch verändert, was die Beliebtheit sinken ließ. Aus diesem Grund suchen viele Unternehmen nach Alternativen für VMware. Der folgende Beitrag thematisiert, welche Optionen und Lösungen es in diesem Bereich gibt.
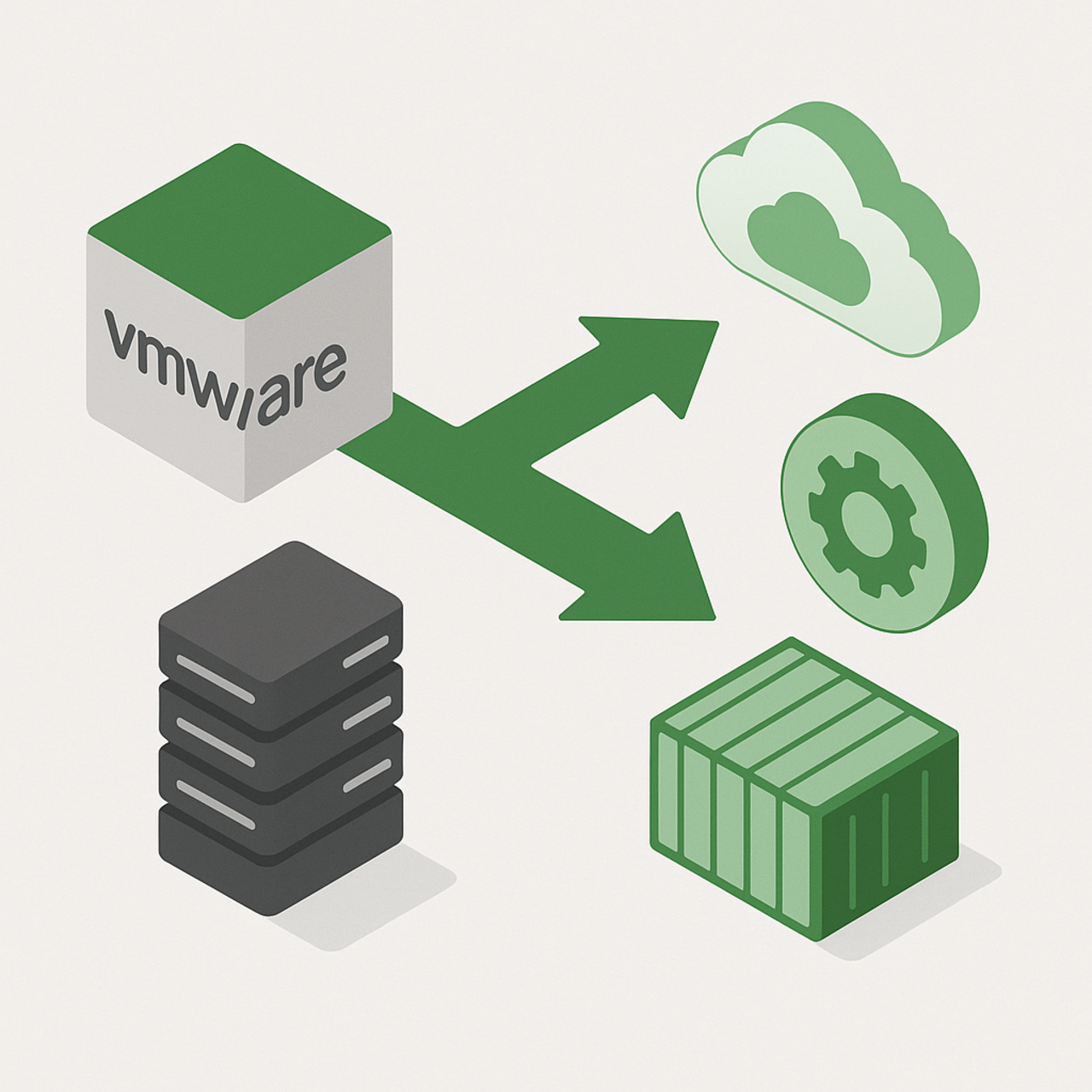
1 VMware – Gründe für die Beliebtheit der Virtualisierungsplattform
Es gab und gibt eine Reihe von guten Gründen, die dafür gesorgt haben, dass VMware lange Zeit die wahrscheinlich beliebteste Lösung für die Virtualisierung war. Zu den Stärken der Virtualisierungsplattform gehören die enorme Funktionalität, die fast unbegrenzte Skalierbarkeit sowie der sehr effiziente Einsatz der Ressourcen in der Infrastruktur. Für die Virtualisierung in Rechenzentren sowie auf lokaler Ebene ist VMware eine enorm praktische Lösung und bietet jeweils passende Lösungen an. Für diese Virtualisierungsplattform spricht weiterhin die enorme Flexibilität bei der Wahl der Umgebungen. Beispielsweise ist nicht nur die Unterstützung von Linux oder Microsoft Windows gewährleistet, sondern auch macOS, FreeBSD und Solaris. Zusammengefasst ermöglicht VMware den Aufbau einer hyperkonvergenten Infrastruktur. Darüber hinaus hat VMware das Portfolio der eigenen Anwendungen immer weiter ausgebaut, vor allem im Bereich der Software für die Cloud.
Warum suchen Anwender inzwischen Alternativen zu VMware?
Der Grund dafür, dass immer mehr Anwender nach alternativen Lösungen suchen, hängt mit der Übernahme der Software im Dezember 2023 zusammen. Der US-Softwarekonzern Broadcom erwarb das Unternehmen hinter der Virtualisierungsplattform mit allen Anwendungen. Nach der Übernahme führte Broadcom ein neues Lizenzmodell ein, das seit Anfang 2024 gilt. In diesem Zusammenhang erhöhte Broadcom die Lizenzkosten für die Nutzung teilweise um den Faktor zehn.
Ebenfalls änderte Broadcom die Möglichkeiten der Lizenzierung und schränkte die Anzahl der Lizenzmodelle ein. So entfiel die Option auf eine Dauerlizenz, die vorher „Perpetual License“ hieß, nach der Übernahme durch Broadcom ersatzlos. Inzwischen bietet Broadcom nur noch jährliche Subscriptions an, die immer wieder verlängert werden müssen. Auch der Support ist direkt an eine aktive Subscription gekoppelt.
Was muss eine alternative Plattform bieten?
In erster Linie geht es bei Alternativen um eine Virtualisierungslösung. Spezifisch müssen alternative Anwendungen aber auch eine Reihe von Funktionen mitbringen, um den Umfang von VMware zu erreichen. Hierbei geht es nicht nur darum, einzelne Funktionen im Bereich der Virtualisierung abzudecken oder separate, lokale VMs zu verwalten. Vielmehr ist es wichtig, bei Bedarf auch eine Vielzahl von VMs in einem großen Cluster zu erstellen und zu verwalten, Wachstum in der Zukunft zu ermöglichen sowie Infrastrukturen mit Containern zu managen.
Außerdem muss eine Alternative in den meisten Fällen eine Hochverfügbarkeit gewährleisten. Eine Hochverfügbarkeit ist einerseits durch eine zuverlässige Umgebung gewährleistet, andererseits aber auch durch einen schnellen Support sowie eine stabile Plattform.
2 Welche Alternativen gibt es zu VMware?
Es gibt durchaus verschiedene Anbieter, die mit VMware vergleichbare Plattformen auf dem Markt haben. In diesem Bereich existieren sowohl Open Source Lösungen als auch kommerzielle Alternativen. Die meisten der Alternativen besitzen dabei sowohl Stärken als auch Schwächen sowie spezifische Unterschiede zu VMware. Dies ist eine Liste von Virtualisierungsplattformen, die echte Alternativen darstellen:
- Proxmox VE
- VirtualBox (Oracle)
- OpenCloud
- Xen Project
- oVirt / Red Hat Virtualization
- Nutanix
- Citrix
Welche der Alternativen sich am besten für die eigene Situation eignet, hängt vor allem von den Ansprüchen sowie den Aufgaben im Bereich der Virtualisierung ab. Dementsprechend gibt es keine allgemeine Antwort, sondern eine individuelle Analyse mit der Suche nach einer Lösung mit den benötigten Funktionen ist erforderlich.
Proxmox VE – Open Source für die Virtualisierung im Cluster
Proxmox VE ist eine Plattform für die Virtualisierung, die Open Source ist. Mit dieser Plattform lassen sich Kernel-basierte VMs erstellen und verwalten. Ebenfalls ist es möglich, Container zu erstellen und zu verwalten. Proxmox VE basiert auf Linux und einem KVM-Hypervisor. Zudem ist kein separater Server für die Verwaltung erforderlich. Proxmox VE unterstützt das Clustering und besitzt interne Funktionen für Backups.
VirtualBox – Virtualisierung für lokale Aufgaben
Ebenfalls weit verbreitet, wenn es um die Erstellung und Verwaltung von VMs geht, ist VirtualBox. Auf den ersten Blick besitzt VirtualBox sehr viele Gemeinsamkeiten mit VMware. Es ermöglicht die Virtualisierung von Ressourcen sowie die Verwaltung von VMs. Der zentrale Unterschied bei der Virtualisierung mit VirtualBox von Oracle ist, dass diese Lösung vor allem für die lokale Virtualisierung mit direktem Zugriff über den Desktop ausgelegt ist. Für die Verwaltung von großen Clustern per Remote-Zugriff ist VirtualBox nicht ausgelegt. Dafür bringt es eine Unterstützung für viele Umgebungen mit Betriebssystemen wie Microsoft Windows, Linux, macOS oder Solaris mit. Aus diesem Grund ist VirtualBox vor allem eine beliebte Plattform für die Entwicklung von Anwendungen. VirtualBox ist zudem Open Source und damit in der Nutzung immer kostenlos.
OpenCloud – die flexible Sammlung für den Aufbau einer individuellen Cloud mit Virtualisierung
Bei einer OpenCloud handelt es sich nicht um eine reine Lösung für die Virtualisierung, sondern um eine Sammlung von Anwendungen. Diese sind alle quelloffen, also Open Source, sodass die Betriebskosten dieser Umgebungen vergleichsweise niedrig sind. OpenCloud-Umgebungen bestehen aus mehreren Komponenten, wie zum Beispiel OpenStack oder OpenNebula. Für jede Aufgabe existieren eigene Anwendungen. Dazu gehören Module für das Computing, Storage, Container oder Networking sowie Kubernetes für die Orchestrierung. OpenCloud nutzt nicht nur einen Hypervisor wie VMware, sondern verschiedene Varianten. Zu diesen zählen KVM, Xen und Hyper-V. Über sehr flexible APIs gelingt die Anbindung untereinander und zu anderen Anwendungen. Das erlaubt es, individuelle Umgebungen in der Cloud zu entwickeln, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Der Nachteil ist, dass es grundsätzlich keinen professionellen Tech-Support gibt. Dieser kann aber von IT-Dienstleistern wie TelemaxX bereitgestellt werden, wenn Unternehmen Umgebungen und Infrastruktur in der Cloud auf Basis dieser Anwendungen mieten.
Xen Project – Fokus auf die Virtualisierung von Servern
Xen Project ist eine weitere Open-Source-Lösung für die Virtualisierung. Hier liegt der Fokus auf der Virtualisierung von großen Umgebungen in Rechenzentren. In erster Linie nutzen somit Anbieter von Diensten in der Cloud und dem Hosting allgemein Xen Project. Für die Verwaltung steht keine eigene grafische Nutzeroberfläche zur Verfügung. Dafür müssen also zusätzliche Tools zum Einsatz kommen. Durch die starke Isolierung sowie die effizienten Workloads ist das Sicherheitsniveau sehr hoch und eine Hochverfügbarkeit kann erzielt werden. Xen Project unterstützt als Gast-Betriebssysteme Linux, Windows und BSD.
oVirt / Red Hat Virtualization – Optionen für KMU
Red Hat Virtualization und oVirt sind zwei Virtualisierungslösungen, die auf derselben Plattform basieren. Red Hat Virtualization ist die kommerzielle Variante von oVirt. Diese ist also kostenpflichtig über Lizenzen, bietet dafür aber auch einen professionellen Support, während oVirt Open Source ist. Die beiden Plattformen bieten interessante Eigenschaften, darunter die Live-Migration von VMs, das Clustering sowie Hochverfügbarkeit von Diensten. Container unterstützen Red Hat Virtualization und oVirt nicht nativ, diese Funktionen lassen sich aber über OpenShift hinzufügen. Die Zielgruppe liegt im Bereich von kleinen und mittleren Unternehmen, die einen höheren Bedarf im Bereich der Virtualisierung haben. Während Red Hat Virtualization eine Enterprise-GUI besitzt, ist bei oVirt ein webbasiertes Management-Dashboard vorhanden. Der Hypervisor KVM ist direkt über Linux integriert. Wissen im Umgang mit Linux ist hier eine Grundvoraussetzung.
3 Ein Vergleich der Kosten – wie schlagen sich die Alternativen?
Besonders seit der Erhöhung der Lizenzgebühren für VMware durch Broadcom nach der Übernahme haben viele Nutzer von VMs einen Blick auf die Kosten geworfen. Hier zeigt sich, dass die Alternativen fast in jedem Szenario mit niedrigeren Betriebskosten glänzen. Natürlich ist eine individuelle Analyse erforderlich, die Faktoren wie die TCO (Total Cost of Ownership) sowie potenzielle spätere Kosten durch die Skalierung beim Wachstum berücksichtigt. Ein zentraler Faktor sind jedoch die Gebühren für die laufende Subscription. Dies liegt vor allem an den deutlich gestiegenen Lizenzgebühren für VMware nach der Übernahme durch Broadcom. Eine einfache Lizenz vSphere Standard für Maschinen mit einer CPU und maximal 16 Cores kostet, Stand Juli 2025, für ein Jahr 56,33 Euro. Dementsprechend entstehen schnell hohe Kosten für Unternehmen, deren Infrastruktur auf eine umfangreiche Virtualisierung setzt. Konzepte mit Open Source, wie etwa OpenCloud, erzeugen in diesem Punkt gar keine Kosten. Zu beachten ist, dass Broadcom 24/7 Kundenservice über alle gängigen Kanäle bietet. Dies ist in den Kosten integriert. Bei Open Source muss der Support über andere Quellen gefunden werden, was eventuell zusätzliche Kosten verursacht oder einen langsameren Support bedeutet.
4 Sicherheit, Migration, Datenschutz und was es noch zu berücksichtigen gibt
Die zentralen Faktoren bei der Virtualisierung und der Cloud sind Sicherheit, Datenschutz, Hochverfügbarkeit, Effizienz und Flexibilität beziehungsweise Skalierbarkeit. Bestimmte Punkte sind dabei kompromisslos, wie etwa die Datenschutz-Grundverordnung der EU, die Betreiber von Diensten auf jeden Fall einhalten müssen. Bei vielen anderen Faktoren gibt es oftmals Spielraum, eventuell sogar bei der Hochverfügbarkeit. Dementsprechend eignen sich alle der Alternativen grundsätzlich als Lösung, abhängig von den Anforderungen.
Die OpenCloud Migration bringt jedoch einige Herausforderungen mit. Zum einen ist eine direkte Migration von VMware zu einer anderen Lösung für die Virtualisierung nicht möglich. Das liegt an dem sogenannten Lock-in-Effekt, den proprietäre Lösungen oft mitbringen. VMs, die über die Plattform von Broadcom VMware erstellt wurden, lassen sich also nicht einfach mit VirtualBox Maschine oder auf einer Infrastruktur mit OpenCloud weiterführen. Zum anderen bringt eine Migration der Plattform auch immer eine Umstellung bei Workloads mit sich. Dementsprechend sollten Unternehmen, die eine Migration weg von VMware planen, eine Übergangszeit einberechnen und am besten einen professionellen Partner wie TelemaxX mit ins Boot holen.




